
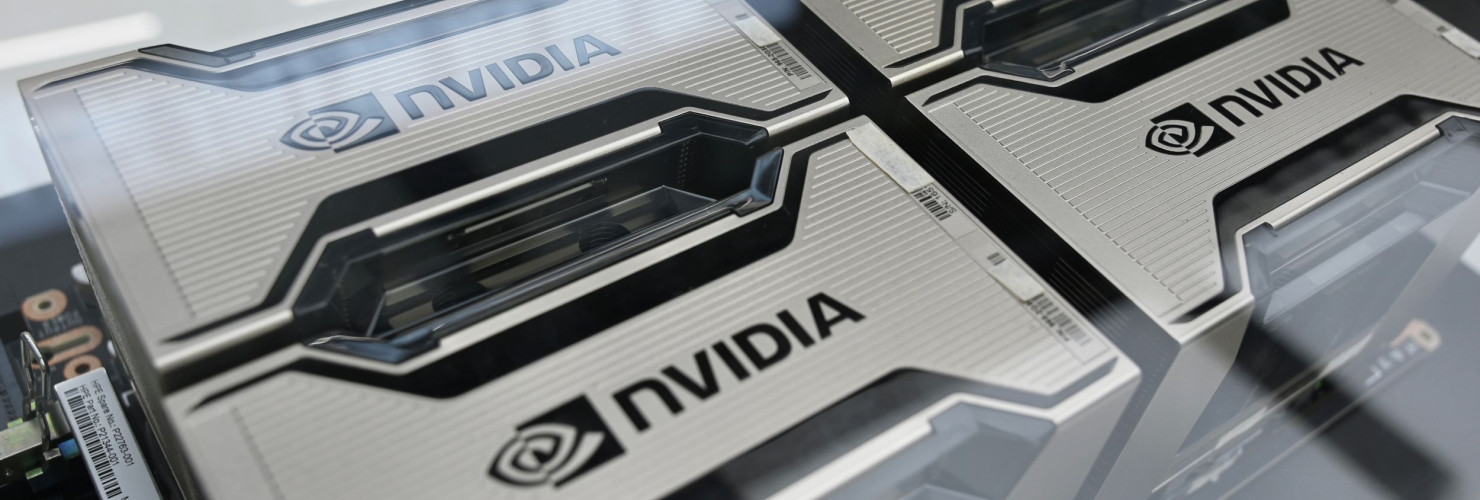
Chinas Investitionen in KI + Plan zur Importsteigerung + Einflussnahme in der Wissenschaft
Top Thema
Chinas riskante Wette im KI-Wettlauf: Billige Energie und massive Investitionen
Anfang November hat die chinesische Regierung Berichten zufolge staatlich finanzierte Rechenzentren angewiesen, ausländische KI-Chips auszusortieren. Diese Maßnahme würde nicht nur US-Chipherstellern wie Nvidia, AMD und Intel Probleme bereiten, sie wäre auch für Beijing mit hohen Kosten verbunden. Offizielle chinesische Quellen bestätigten dies allerdings nicht.
Alle Rechenzentren, die erst zu weniger als einem Drittel fertiggestellt sind, sollen den Berichten zufolge bereits verwendete Chips ausbauen und ersetzen. Die meisten Rechenzentren in China werden direkt oder indirekt staatlich finanziert. Chinesische Halbleiteraktien schnellten angesichts der Berichte in die Höhe, da Anleger nun steigende Nachfrage nach ihren Produkten erwarten.
China ändert derzeit seine Strategie beim Aufbau von Recheninfrastruktur. Nvidia-Chef Jensen Huang warnte zuletzt, der Anteil von Nvidia am chinesischen Markt für Grafikkarten (GPU) drohe von 95 Prozent auf null zu sinken. Diese Schätzung könnte übertrieben sein, da die Regierung Trump den Verkauf von H20-Chips durch Nvidia noch erlaubt und Nvidia immer noch rund 54 Prozent des chinesischen Marktes hält. Beijing hat allerdings einheimische Firmen ermahnt, diese Chips nicht zu kaufen.
Beijing setzt bei Chips nun stark auf einheimische Akteure und nimmt potenziell hohe Kosten in Kauf. Trotz erheblicher Verbesserungen stehen einheimische Unternehmen wie Huawei und Moore Threads immer noch vor großen Hürden, um eine mit Nvidia vergleichbare Leistung und Produktionskapazität zu erreichen.
In Beijing scheint man jedoch davon auszugehen, dass China es sich leisten kann, die Branche zu subventionieren, bis sich die Wette auszahlt. Inländische Chips benötigen aufgrund ihrer weniger effizienten Prozesse schätzungsweise 30 bis 50 Prozent mehr Strom als ein H2O-Chip, um die gleiche Leistung zu erzielen. Um die Kosten zu senken, hat die Regierung gerade einen Stromrabatt von bis zu 50 Prozent für Rechenzentren versprochen, die inländische Chips verwenden. Strom ist in China ohnehin schon viel billiger als in den Vereinigten Staaten.
“Auch wenn China einheimische Chips als Ersatz verwendet, wird es ganz ohne Nvidia nicht gehen. Beijings Entschlossenheit zeigt aber, dass es einheimische Alternativen um fast jeden Preis fördern will. In den USA gibt es bereits gesellschaftlichen Widerstand gegen den Bau riesiger KI-Rechenzentren, der in autoritär regierten Ländern undenkbar wäre. Im Gegensatz zu liberalen Marktwirtschaften mit freien Gesellschaften toleriert China auch Ineffizienz und nimmt gegebenenfalls auch große Verluste in Kauf, um strategische Ziele zu erreichen.“
Rebecca Arcesati, Lead Analystin, MERICS
Medienberichte und Quellen:
- Reuters: China bans foreign AI chips from state-funded data centres, sources say
- Ifeng (CN): 用国产芯片电费最多降50% 贵州等为字节阿里腾讯数据中心提供补贴 (Electricity costs reduced up to 50 percent if domestic chips are used, Guizhou and others provide subsidies for ByteDance, Alibaba, Tencent data centers)
- South Reviews (CN): Full substitution, Nvidia disillusioned
- SemiAnalysis: Huawei AI CloudMatrix 384 – China's Answer to Nvidia GB200 NVL72
METRIX
3,6 Terawatt
Das ist die Kapazität an installierter Solar- und Windenergie, die China bis 2035 erreichen will, wie Beijing kurz vor der COP30-Klimakonferenz in Brasilien bekannt gab. Chinas Ausbau erneuerbarer Energien schreitet außerordentlich schnell voran. Zwischen Januar und Juli wurden 50 Gigawatt Wind- und 210 Gigawatt Solarenergie in das chinesische Netz eingespeist. Chinas installierte Gesamtleistung aus diesen erneuerbaren Energien liegt nun bei 1.668 Gigawatt. 2025 wird voraussichtlich das dritte Jahr in Folge, in dem das Land seinem Netz erneut mehr als 300 Gigawatt an Wind- und Solarenergie hinzufügt. Zum Vergleich: Die insgesamt installierte Leistung der EU belief sich Ende 2024 auf lediglich 231 Gigawatt aus Windkraft und 338 Gigawatt aus Solarenergie. Auch wenn China weiterhin Kohle zur Energiegewinnung nutzt – der rasche Ausbau erneuerbarer Energien und die Tatsache, dass Chinas CO2-Emissionen seit 18 Monaten stagnieren, geben Anlass zur Hoffnung, dass der Ausstoß des weltweit größten Emittenten seinen Höchststand erreicht hat. (Quelle: United Nations Climate Change: China’s 2035 National Determined Contributions)
Themen
China verstärkt wirtschaftliche Integration mit Südostasien
Einen Tag nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim hat Chinas Ministerpräsident Li Qiang gemeinsam mit Anwar eine neue Freihandelszone von China und dem ASEAN-Bündnis besiegelt. Das neue Abkommen CAFTA 3.0 soll durch die Integration der Chinas und der ASEAN-Staaten einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen. In neun zentralen Bereichen wollen beide Seiten zusammenarbeiten, unter anderem bei den Themen nachhaltige Wirtschaft und Vernetzung von Lieferketten. Ohne explizit auf die Spannungen zwischen den USA und China einzugehen, sagte Li, beide Seiten würden „Störungen von außen verhindern, ihre legitimen Interessen durch gegenseitige Abhängigkeit wahren und durch verstärkte Zusammenarbeit Wachstum fördern“.
Aufgrund der schwierigen Beziehung zu den USA will Chinas Regierung Exporte diversifizieren, dabei setzt sie auch auf Südostasien. Die Staaten in der Region wollen jedoch einen Zustrom billiger Waren aufgrund der industriellen Überkapazitäten Chinas verhindern. Manche haben Handelsbeschränkungen erlassen, um ihre einheimische Produktion vor der Konkurrenz aus China zu schützen – und Beijing scheint bereit zu sein, begrenzte wirtschaftliche Gewinne in Kauf zu nehmen, um neue geopolitische Einflussmöglichkeiten in Südostasien zu erlangen.
Das neue CAFTA-Protokoll kann als strategischer Sieg Chinas im Wettbewerb mit den USA gewertet werden. Wirtschaftlich eröffnet es neue Märkte für chinesische Solarmodule, Elektrofahrzeuge und Batterien und trägt so zur Entlastung der heimischen Überkapazitäten bei. Politisch stärkt es die Beziehungen Chinas zur ASEAN, insbesondere vor dem Hintergrund des verschärften Wettbewerbs zwischen Washington und Beijing und Trumps „America First“-Ansatz. Laut Mitteilung der chinesischen Regierung zielt das Freihandelsabkommen darauf ab, „Multilateralismus und freien Handel aufrechtzuerhalten und eine offene, inklusive und regelbasierte regionale Ordnung für eine Kooperation zu beiderseitigem Nutzen zu fördern”.
„Inwieweit der ASEAN-Markt den Rückgang der chinesischen Exporte in die USA kompensieren kann, bleibt abzuwarten. Das neue CAFTA-Protokoll positioniert Beijing jedoch als maßgebliche, Normen gestaltende Kraft der regionalen Integration und ermöglicht es China, sich im Gegensatz zu den USA als positive Kraft für eine regelbasierte internationale Ordnung zu positionieren.“
Claus Soong, Analyst, MERICS
- It’s not us, it’s you: China’s surging overcapacities and distortive exports are pressuring many developing countries too - MERICS China Global Competition Tracker No. 3 2024
Medienberichte und Quellen:
Neues Programm gegen Handelsungleichgewichte bekämpft Ursachen nicht
Angesichts anhaltender Überschüsse in Chinas Handelsbilanz haben Regierungschef Li Qiang und Handelsminister Wang Wentao einen Plan zur Ausweitung der Importe aus Drittländern vorgestellt. Im Rahmen des Programms mit dem Titel „Großer Markt für alle: Export nach China” sind mehr als hundert Veranstaltungen pro Jahr geplant, darunter Initiativen zur Vernetzung ausländischer Produzenten mit chinesischen Verbrauchern und zur Vermittlung von Partnerschaften auf regionaler und sektoraler Ebene. Das Programm soll zudem die Sichtbarkeit ausländischer Unternehmen durch Werbekampagnen und Messen erhöhen.
Angekündigt wurde die Kampagne am 4. November, kurz vor Beginn der achten Ausgabe der China International Import Expo (CIIE). Xi Jinping hatte die Messe 2018 ins Leben gerufen – auch als Reaktion auf die wachsende Kritik an Chinas einseitiger Handelsbilanz mit zahlreichen Ländern. Doch der Handelsbilanzüberschuss der Volksrepublik hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt und ist um 89,9 Prozent gestiegen. In diesem Jahr dürfte der Rekordwert von 1 Billion US-Dollar aus dem Jahr 2024 noch einmal übertroffen werden.
Die schwachen chinesischen Importe sind vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen: die trotz der Bemühungen Beijings anhaltend geringe Nachfrage chinesischer Verbraucher, den Abschwung im Immobiliensektor, der auch die Nachfrage nach Zwischenprodukten dämpft, und Chinas Bestreben, seine Industrie unabhängig vom Ausland zu machen. Daher dürfte die Ankündigung von Li und Wang nicht zu einer grundlegenden Neugewichtung des Handels führen. Die Europäische Handelskammer in China bezeichnete die CIIE bereits 2023 als „politische Showbühne”.
„Die Schwäche der chinesischen Importe resultiert aus Problemen, die weit darüber hinausgehen, was der Plan ‚Großer Markt für alle: Export nach China‘ angehen soll. Für ausländische Unternehmen ist nicht mit einem bedeutenden Anstieg der Importe zu rechnen, da es keine umfassenden Maßnahmen zur Förderung des Binnenkonsums, gegen den Abschwung des Immobilienmarkts und Anpassungen der auf Selbstversorgung ausgerichteten Industriepolitik des Landes gibt.”
Esther Goreichy, Visiting Fellow, MERICS
- China’s economic policy holds line as growth weakens, MERICS Economic Indicators Q3/2025
- ECB: China’s growing trade surplus: why exports are surging as imports stall
Medienberichte und Quellen:
- Securities Times (CN): “共享大市场·出口中国”系列活动正式启动 (“Shared Market, Export China” Series of events officially launched)
- Reuters: China plans events to boost imports, promises “win-win cooperation”
- Bloomberg: China Launches Import Promotions to Address Imbalance Concerns
Britische Regierung untersucht chinesische Einflussnahme auf Wissenschaft
Nachdem die britische Sheffield Hallam University Anfang dieses Jahres unter Druck aus China die Arbeit einer Menschenrechtsforscherin eingestellt hatte, untersucht die britische Regierung nun den Verdacht staatlicher chinesischer Einmischung in die Wissenschaft. Berichten zufolge wird London den sogenannten China Audit ausweiten, der die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Aspekte der Beziehungen zu China bewertet. Zudem hat London Anti-Terror-Experten beauftragt, den Fall zu untersuchen. Dieser zeigt die Schwächen demokratischer Systeme im Umgang mit Angriffen auf die Rede- und Wissenschaftsfreiheit auf.
Die Universität hat sich unterdessen bei Laura Murphy entschuldigt. Die Professorin für Menschenrechte hat in den vergangenen Jahren Forschungsarbeiten zur Zwangsarbeit von Uiguren in chinesischen Lieferketten angeleitet. Murphys Anwälten zufolge geht aus Unterlagen der Universität hervor, dass die Entscheidung über die Einstellung eines von Murphys Forschungsprojekten nach Drohungen chinesischer Sicherheitsdienste getroffen wurde.
Selbstzensur aufgrund von Drohungen und Einschüchterungen könnte weiter verbreitet sein als bekannt, da Betroffene oft weitere Anfeindungen, Anwaltskosten oder andere finanzielle Verluste vermeiden wollen und diese nicht melden. Zugleich fehlt es vielerorts an Unterstützung der Betroffenen, zum Beispiel durch Leitlinien, wie mit chinesischen Staatssicherheitsbehörden umzugehen ist (oder wie man sich ihnen verweigert), aber auch für die Stärkung von Mechanismen für die Berichterstattung und Reaktion der Strafverfolgungsbehörden. Universitäten sollten aktiver gegen Zwangsmaßnahmen vorgehen, die ihre akademische Integrität bedrohen.
„Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie deren Mitarbeiter sind rechtlichen und physischen Bedrohungen ausgesetzt. Europäische Regierungen müssen sich stärker darum bemühen, bessere Instrumente wie Meldepflichten und Schulungen zur Forschungssicherheit bereitzustellen, und sie sollten akademische Einrichtungen dazu ermutigen, Drohungen öffentlich zu machen.“
Daria Impiombato, Senior Analyst, MERICS
Medienberichte und Quellen:
VIS-À-VIS
Joseph Torigian über Xi Jinpings Vater, Xi Zhongxun
MERICS China Essentials Briefing hat mit Joseph Torigian gesprochen, Associate Professor an der School of International Service der American University in Washington, über sein Buch über Xi Zhongxun gesprochen. Die erste englischsprachige Biographie von Xi Jinpings Vater erschien im Juni. Xi Zhongxun spielte eine wichtige Rolle in der kommunistischen Revolution in China, im Laufe seiner Karriere wurde er auch mehrfach verfolgt und inhaftiert.
Xi Zhongxun, Vater von Xi Jinping, galt als vorbildliches Parteimitglied. Warum ist er eigentlich außerhalb von Fachkreisen, die sich mit der Geschichte der Kommunistischen Partei befassen, nicht besser bekannt?
Xi Zhongxun zeichnet sich dadurch aus, dass er bereits in jungen Jahren in sehr einflussreiche Positionen befördert wurde. Er war 1945 auf dem Siebten Parteitag der jüngste Kandidat für das Zentralkomitee. Außerdem war er 1959 der mit Abstand jüngste Vizepremier. Es stellt sich die Frage, warum er so schnell aufstieg, aber nie an die Spitze gelangte.
Ein wichtiger Grund dafür ist vermutlich Deng Xiaoping. Die beiden hatten ein angespanntes Verhältnis. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie verfeindet waren. Innerhalb der Partei gab es außerdem verschiedene Arten von Experten – für Militär, Außenpolitik, Wirtschaft. Xi Zhongxun war eher ein Experte für Menschen, für „politische Widersprüche“. Er erledigte oft das Tagesgeschäft für die Mächtigeren.
In vielerlei Hinsicht war es Xi, der herausarbeitete, wie politische Maßnahmen umgesetzt werden. Das mag langweilig klingen, aber Xis Leben zeigt, dass solche Staatsbediensteten wie er sich in einem wirklich schwierigen politischen Umfeld bewegten. Sie erhielten Richtlinien für ihre Arbeit, aber herauszufinden, was genau zu tun war, war tatsächlich sehr schwierig und mitunter gefährlich, weil niemand etwas falsch machen wollte. Man wollte nicht der ideologischen Ketzerei bezichtigt werden. Und man wollte auch nicht beschuldigt werden, gegen die Erwartungen der obersten Führer zu handeln, selbst wenn man nicht genau wusste, was diese Erwartungen waren.
Wie hätte wohl die Kommunistische Partei so ein Buch über Xis Vater geschrieben?
Es gibt sogar eine offizielle Biografie, eine offizielle Chronologie und eine TV-Serie. Man könnte nun annehmen, dass solche Veröffentlichungen viele Unwahrheiten enthalten, um Xi Zhongxun in einem guten Licht darzustellen. Doch überraschenderweise sind viele dieser Werke historisch korrekt und nur insofern irreführend, dass sie bestimmte Ereignisse unterschlagen.
Denn das Problem ist: Wenn man die ganze Wahrheit wiedergeben will, muss man auch über Fehler sprechen. Aber es ist schwierig, die Partei als unfehlbare weltgeschichtliche Kraft darzustellen und gleichzeitig über Momente zu sprechen, in denen sie versagt hat. Das passt dann nicht in das Bild einer Organisation, die idealistisch und immer zielstrebig agiert. Das Image, das Xi Jinping geschaffen hat, weil er denkt, dass es für das Überleben der Partei wichtig ist.
Nach Maos Tod und nach Beginn der Reformen und Öffnung verbrachte Xi Zhongxun viel Zeit damit, die Wahrnehmung seiner Person richtig zu stellen.
Das stimmt. Wenn sich deine Arbeit und der Sinn deines Lebens ausschließlich darum drehen, wie die Partei deine Vergangenheit charakterisiert, dann ist dir das wirklich wichtig. Das Problem ist, dass es viele interne Machtkämpfe innerhalb der Partei gab und viele Fehler gemacht wurden. Es steht also oft die Frage im Raum, wem man die Schuld gibt.
Xi Zhongxun war verärgert darüber, dass im Grunde alle positiven Ereignisse der Vergangenheit Deng Xiaoping zugeschrieben wurden und dass andere durch die Geschichtsschreibung reingewaschen wurden, zum Beispiel Maos Nachfolger Hua Guofeng und die führenden Persönlichkeiten der 1980er Jahre wie Hu Yaobang und Zhao Ziyang.
Tatsächlich schrieb Xi Zhongxun während der 16 Jahre, die er in der politischen Verbannung verbrachte, immer wieder Autobiografien und versuchte, seine Version der Vergangenheit von der Partei genehmigen zu lassen. Ich denke, das sagt auch viel über die Partei aus.
Das Interview ist ein Auszug aus einem demnächst erscheinenden MERICS China Podcast.
MERICS China Digest
Spaniens König Felipe VI. trifft Xi Jinping (Reuters)
Im Rahmen des ersten offiziellen Staatsbesuchs eines spanischen Monarchen nach China seit 18 Jahren, empfing Chinas Staatspräsident Felipe am 12. November in Beijing. Beide Staaten versprechen sich Vorteile von der Annäherung: China sucht einen Verbündeten zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten mit der EU, während Spanien an chinesischen Investitionen interessiert ist. (13.11.25)
Deutsche Regierungskoalition plant China-Kommission (Deutscher Bundestag)
Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD wollen eine Kommission einrichten, die sich mit der Überprüfung der sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China befassen soll. Das Expertengremium soll dem Bundestag jährlich seine Prüfungsergebnisse und Handlungsempfehlungen vorlegen. (12.11.25)
In einem Telefonat mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao forderte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche Lockerungen der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden. Zuletzt hatten ausbleibende Lieferungen von Nexperia-Halbleitern die deutsche Automobilindustrie stark beunruhigt, doch China ist der EU seitdem mit Lockerungen entgegengekommen. (11.11.25)
Der Programmentwurf für Horizon Europe 2026 sieht vor, dass in China ansässige Institutionen von den Clustern in den Bereichen Gesundheit, zivile Sicherheit und Gesellschaft sowie digitale Industrie und Raumfahrt ausgeschlossen werden sollen. Mit dem chinesischen Ministerium für Industrie und Technologie assoziierte Institutionen, das betrifft vor allem Universitäten mit engen Verbindungen zum Militär, würden gänzlich von der Teilnahme ausgeschlossen. (11.11.25)
Bericht: Bürokratiefehler sorgt für Abschiebung uighurischer Frau nach China (Hong Kong Free Press)
Berichten zufolge wurde die uighurische Frau, deren Asylantrag vom BAMF abgelehnt worden war, von den niedersächsischen Behörden nach China abgeschoben, obwohl eine Einreiseverfügung für die Türkei vorgelegen hätte. Der Frau gelang von Beijing die schnelle Ausreise in die Türkei. Der Vorfall zog Kritik und Bedauern nach sich. (11.11.25)